Blick ins Buch
Acht Jahre lang dauerte der Bau des Flavischen Amphitheaters,
wie man das Kolosseum in der Antike nannte, ehe es im Jahr
80 n. Chr. zum ersten Mal für die Öffentlichkeit seine Pforten
öffnete. Doch seine Geschichte begann nicht erst mit der
Grundsteinlegung, sondern bereits vier Jahre früher, in jener
Nacht, als Rom in seinen Fundamenten erbebte …
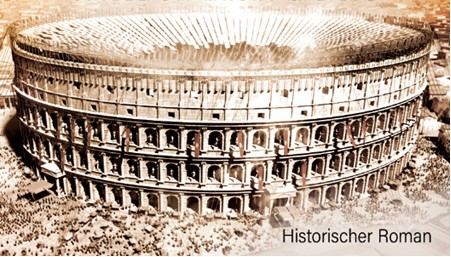
Wo kann man das Buch kaufen?
1 – Cäsarendämmerung
Rom, 8. Juni 68 n. Chr.
Niemals zuvor hatten Senatoren einen solchen Affront gewagt, ein so unglaublich skandalöses Sakrileg begangen wie an diesem Tag. Wie Diebe schlichen sie sich durch die einsamsten Gassen Roms, verkrochen sich heimlich in einem Tempel am Rande der Stadt und erklärten ihn, Nero, den Imperator, Cäsar und Pontifex maximus, zum Staatsfeind. Niemand durfte ihn mehr unterstützen, jedermann ihn ungestraft töten.
Eine knappe Stunde zuvor – Nero wollte sich beizeiten zur Nachtruhe begeben – hatte er die Nachricht von seinen Spionen erhalten. Seitdem war er in Trübsal verfallen. Im Nachthemd stützte er sich mit nackten Ellbogen auf der steinernen Balkonbrüstung ab, umfasste seine Wangen mit beiden Händen und starrte mit krummem Rücken und leerem Blick in den Palastgarten hinaus.
Er mochte so geraume Zeit verharrt haben, als ihn ein Rascheln auf dem Fußboden aus seinen Gedanken riss. Der Papyrus mit dem gebrochenen Siegel des Senats wirbelte im Luftzug hoch. Das bedeutete, jemand hatte die Tür geöffnet. Soldatenstiefel klackten auf dem Marmorboden. Sein Puls raste, das Blut schoss ihm heiß in den Kopf. Dass sie ihn schon jetzt holten, hatte er nicht erwartet. Er richtete sich auf und riskierte einen Blick über die Schulter hinweg, nur kurz, um seine Anspannung zu verbergen.
Der Prätorianerpräfekt Nymphidius Sabinus betrat das halbdunkle Gemach – er kam allein und unbewaffnet. Das war ein gutes Zeichen.
Nero nahm sich vor, den Senatsbeschluss nicht weiter zu beachten, atmete tief durch und sagte, sich betont beiläufig gebend: »Im Garten brennen heute viele Fackeln, sehr viel mehr als sonst, Nymphidius.«
»Ja, mein Kaiser. Sei unbesorgt. Hier bist du sicher. Der Feuerschein ist so hell, dass er jeden daran hindern wird, sich in den Palast einzuschleichen. Außerdem habe ich die Wachen verstärkt.« Der Präfekt blieb einige Schritte hinter Nero stehen. Sein goldener Brustpanzer, auf dem der Widerschein der Flammen glänzte, und der leuchtende Helm mit den weißen Straußenfedern, den er mit seinem linken Arm festhielt, bildeten einen skurrilen Gegensatz zum Nachthemd des Kaisers.
Nero neigte den Kopf zur Seite und nickte über die Schulter hinweg. »Danke Nymphidius«, sagte er leise, beinahe demütig, wie ein Mann, dem man einen Gefallen erwiesen hat. »Nur diese eine Nacht noch, dann verlasse ich Rom. – Ist der Bote aus Ostia schon zurück?«
»Ja, mein Kaiser. Er ist soeben angekommen und bringt gute Nachricht: Eine Trireme liegt im Hafen von Ostia am Kai, bereit zum Ablegen nach Alexandria. Der Präfekt von Aegyptus erwartet dich. Hier ist sein Brief.«
Nero murmelte in sich hinein: »Mein treuer Freund Julius Alexander; er hält noch zu mir.« Dann wandte er sich um, das weiße, mit feinen Goldfäden bestickte Nachtgewand fest um sich schlingend, als fröstelte es ihn. Seine Haltung war gekrümmt, die Schultern hingen herab, und seine dünnen Waden, die aus dem Nachthemd herausschauten, wirkten zerbrechlich unter dem Gewicht der Leibesmasse. Er nahm die Schriftrolle entgegen, hielt sie im trüben Schein eines Kandelabers dicht vor sein aufgedunsenes Gesicht und las, ohne eine Miene zu verziehen.
»Es scheint, als gäbe es
noch genug treue Männer.« Damit reichte er den Papyrus dem Präfekten zurück.
»Bei Sonnenaufgang brechen wir auf.«
»Ja, mein Kaiser.«
Nero wandte sich wieder
dem Garten zu. Sein Blick verlor sich in den wogenden Wipfeln der
Säulenzypressen, an denen ein heftiger Wind rüttelte. »In den Tavernen wird man
sich morgen über mich die Mäuler zerreißen«, sagte er zynisch. »Nero, der
Staatsfeind, ist geflohen. Welch eine Nachricht. Aber sie ahnen nicht, was sie
bedeutet.«
»Nein, mein Kaiser. Deine
Feinde freuen sich zu früh.«
»Ich werde hinter meiner
Standarte die Legionen aus dem Osten versammeln, eine gewaltige Streitmacht.
Die Verräter werden es bereuen.« Er ballte die Fäuste so fest, dass sie
zitterten. »Wir werden sie alle töten. Nicht wahr, Nymphidius?«
»Ja, mein Kaiser.«
Nero fuhr abrupt herum.
Er schaute dem Präfekten fest in die Augen. »Sie werden es nicht wagen, uns auf
dem Weg nach Alexandria aufzuhalten. Oder?«
Die entschlossenen Züge
in seinem Gesicht fielen auf einmal in sich zusammen. Er ärgerte sich über das letzte
Wort, über dieses Eingeständnis des Selbstzweifels, das ihm über die Lippen
gerutscht war. Noch vor wenigen Tagen hätte er Todesurteile verhängt. Doch
jetzt war er ein anderer geworden, einer, den man abserviert hatte, der sich in
den Servilianischen Gärten verkroch, im Süden Roms, nahe dem Stadttor an der
Straße nach Ostia. Aber dennoch. Das ODER verzieh er sich nicht. Wenigstens
Charakter musste er jetzt noch zeigen. Noch war nichts verloren.
»Nein, mein Kaiser. Sie
werden es nicht wagen«, pflichtete ihm Nymphidius bei.
In Neros Augen blitzte
eine Spur von Misstrauen auf. Die Antwort genügte ihm nicht. Er vermisste die
Leidenschaft des Präfekten und fragte sich: Durfte er vom Befehlshaber der
Leibgarde nicht erwarten, dass er beteuerte, notfalls für ihn sein Leben zu
opfern? Gerade jetzt, da die Feinde offen den Tod seines Kaisers forderten?
»Die Prätorianer sind mir
doch treu?« Seine eigenen Worte erschreckten ihn. Die nackte Angst hatte ihm
die Frage in den Mund gelegt. So etwas fragte man nicht. Nein. Ein Kaiser
musste das wissen, bei Strafe seines Untergangs.
»Natürlich seid ihr mir
treu«, korrigierte er sich, noch ehe der Präfekt erwiderte.
Auf dem Weg zum Schlafgemach
klopfte er Nymphidius auf die Schulter. »Ich weiß, ihr seid mir treu«,
wiederholte er apathisch. »Ihr seid es nicht, die mich um den Schlaf bringen.«
Im Bett rieb er sich die
blutunterlaufenen Augen und hoffte, endlich einmal durchzuschlafen. Gegen
Mitternacht jedoch schrie er mit fuchtelnden Armen: »Geh fort, geh fort!«
Schweißgebadet wälzte er sich im Laken hin und her, bis er kurz atmend
aufwachte und begriff: Es war nur ein Traum, einer von diesen bösen, die ihn
schon nächtelang peinigten. Seine erste Ehefrau Octavia war ihm aus dem
Totenreich erschienen. Sie hatte ihn in eine stockfinstere Gruft geschleppt.
Tausende geflügelte Ameisen waren ihm dort über den Leib gekrochen – ein
schreckliches Traumzeichen.
Das Geräusch des Regens,
der auf den Fenstersims tröpfelte, ließ ihn wieder ruhig atmen, seine Schultern
sanken zurück ins Bett, und der Nackenkrampf löste sich. Schlaftrunken
blinzelte er. Doch plötzlich richtete er sich auf.
An der friedlichen Wahrnehmung stimmte etwas nicht.
Und nach zwei Atemzügen kannte er den Grund seines Unbehagens: Es war die Dunkelheit. Er vermisste den vertrauten Widerschein der Fackeln, der in den letzten Nächten, von Vorhängen gedämpft, zu ihm hereingedrungen war. Er erschrak bis ins Mark.
Mit aufgerissenen Augen erkannte er nur schwache Schemen. Sie gehörten nicht zum Schlafgemach seines jüngst erbauten Prunkpalasts. Allmählich kam er zu sich und überlegte, wie viele Tage seit seiner Flucht aus den Gärten des Goldenen Hauses vergangen waren. Waren es fünf oder sieben?
Dieser Traum, fragte er sich, was bedeutete er? Die Gruft! War sie sein eigenes Grab? Bei den Göttern, Octavia hatte ihn gewarnt. Er musste fort von hier. Jetzt gleich, nicht erst im Morgengrauen.
Er tastete nach der Kordel über seinem Bett und zog daran. Doch das Läuten des Glöckchens am anderen Ende des Seilzuges schien keiner der Kammersklaven zu hören.
»Verdammtes verschlafenes Pack«, schrie er und zog erneut, dieses Mal kräftiger. Und als sich immer noch nichts regte, zerrte er so heftig daran, dass die Schnur abriss und ihm auf den Kopf fiel.
»Bei den drei Furien.« Wütend schleuderte er die Kordel von sich fort. »Kann man sich auf niemanden mehr verlassen?«
Sein Geschrei war so laut, dass es einen jeden aufgeweckt haben musste. Doch statt einer Antwort heulte nur eine Windbö. Es klang für ihn wie der Leidensgesang der gepeinigten Seelen aus der Unterwelt, und es dünkte ihm, als riefen sie erwartungsvoll seinen Namen.
Da packte ihn die Panik. Er sprang aus dem Bett. Wie man die Öllampen anzündete, wusste er nicht. Er hatte es nie getan. So hastete er im Dunkeln zur Tür und stolperte dabei über seine am Abend achtlos hingeworfene Kleidung. Er stürzte. Den Schmerz, den ihm das Knie verursachte, vergaß er in der Wut auf die Sklaven, welche die Gewänder nicht fortgeräumt hatten.
»Ich schwöre beim heiligen Stein des Jupiter«, schrie er auf Knien. »Ich werde euch auspeitschen lassen.«
Gleich würde er sicher Schritte hören oder das Knallen von Soldatenstiefeln.
Doch abermals regte sich kein Laut.
Da lähmte seine Wut ein furchtbarer Gedanke, der aus seinem flauen Magen in den Kopf hinaufkroch und ihm den Atem stocken ließ.
War er verlassen? Seinen Feinden wehrlos ausgeliefert?
Er raffte sich wieder hoch, riss die Tür auf und erschrak über die Dunkelheit des Korridors. Hilfesuchend schrie er: »Nymphidius Sabinus!«
Mit angehaltenem Atem und böser Ahnung horchte er in die Finsternis. Doch niemand antwortete. Nicht einmal seine alten Gardisten, die Evocati, kamen ihm zu Hilfe.
Es herrschte Stille. Nur der Regen klopfte leise gegen die Fensterscheiben, und der Pulsschlag hämmerte gegen seine Schläfen. Die Kälte kroch ihm unter das Nachthemd, und er zitterte am ganzen Leib. Seine Blase drückte. Nur mühsam hielt er das Wasser zurück, denn er ahnte seine Todesstunde nahen.
Er dachte an den Senatsbeschluss, den er vor Stunden mit zitternden Händen gelesen hatte. Die Strafe, die ihm der Sekretär für Bittgesuche prophezeite, hatte ihn so tief im Inneren erschüttert, dass ihm das Grauen noch immer in den Knochen steckte. Nackt sollte er an die Furca gefesselt, den Hals zwischen den V-förmigen Gabeln eingeklemmt, mit schweren Ruten bis zum Tode geprügelt werden. Kein Krümmen des Leibes, kein Abwenden des Gesichtes würde das Leiden lindern können.
Diese schrecklichen Gedanken trieben ihn zurück an sein Bett. Er griff nach den beiden Dolchen unter dem Kopfkissen; der mit dem Rubin am Knauf, so beschloss er, sollte sein Schicksal bestimmen. Er prüfte mit dem Zeigefinger die Spitze und mit dem Daumen die Schneide. Dann führte er die Klinge an seinen Hals. Doch der Schmerz, den der gegen die Haut gepresste Stahl verursachte, raubte ihm sogleich den Mut. »Oh, ihr Götter, gebt mir die Kraft zum Sterben.«
War es ein Windstoß, der ihn gestreift hatte, oder ein Hauch aus dem Hades? War es das Singen des Sturmes oder ein göttliches Flüstern, das ihm Einhalt gebot, als wäre der düstere Fährmann Charon noch nicht bereit, ihn über den Fluss Styx ins Totenreich zu führen? War diese Stimme das lang ersehnte Zeichen der Hoffnung? Würden ihm die Götter in höchster Not endlich die verlorene Macht zurückgeben, die er so geliebt und so gefürchtet hatte?
Sein Lebenswille kehrte zurück, gleichzeitig entbrannte erneut die Wut auf jene Generäle, die ihm in den Rücken gefallen waren. Vor vier Monaten hätte es niemand gewagt, sich gegen ihn, den Sohn des vergöttlichten Claudius, zu stellen, über dessen Haupt die Strahlenkrone des Apollo leuchtete und der das Imperium Romanum wie kein Zweiter verkörperte.
Doch jetzt trachtete ihm General Galba, dieser Usurpator aus Hispania, und dessen Gefolgschaft nach dem Leben. Wo waren sie geblieben, die ihm Treue bis in den Tod geschworen hatten? Es war so unfassbar, als wäre es nicht wahr, als wäre es nur einer der schrecklichen Albträume, der bald wie Morgennebel in der Sonne verfliegen würde.
Doch er wusste, er war schon lange erwacht.
Plötzlich entdeckte er durch den Spalt der halboffenen Tür ein unruhiges Licht. Schritte hallten. Sie kamen näher. Das hörte sich nicht an wie das Klacken von Soldatenstiefeln und auch nicht wie das markante Trotten der Kammersklaven. Wer immer da kommen mochte, er war bereit, mit beiden Dolchen in den Händen sein Leben mutig und entschlossen zu verteidigen.
Nachdem sich die Tür vollständig geöffnet hatte, erkannte er den Freigelassenen Lucius Domitius Phao. Sein Gesicht wurde durch das Licht der Öllampe, die er in der Hand trug, von bizarren Schatten überzogen. Ihn begleitete der Kabinettssekretär Epaphroditus, dessen beleibte Silhouette wie ein großes Gespenst Schatten über die Wände warf.
»Wie können wir dir helfen, Herr?«, fragte Phao fürsorglich.
Er atmete auf, erleichtert, aber noch immer mit weichen Knien. »Ich muss nachdenken, Phao«, flüsterte er mit zittriger Stimme. »Doch hier bin ich nicht sicher. Hilf mir!«
»Herr«, sprach Phao laut. »Ich kenne eine verlassene Villa, keine vier Meilen von Rom entfernt zwischen der Via Salaria und der Via Nomentana. Dort wird man dich nicht suchen.«
Für diese Loyalität, die er früher so wenig gewürdigt hatte, empfand er in dieser Stunde höchster Gefahr eine umso größere Dankbarkeit. Ihn durchströmte eine lange verschüttete Wärme gegenüber seinen letzten getreuen Männern. Und er hoffte sogleich auf Rettung.
Mit verschlafenen Augen trat auch Sporus hinzu, sein junger vertrauter Eunuche. Er holte aus der Kammer eines geflohenen Sklaven einen ausgefransten Mantel mit Kapuze, damit niemand den Kaiser auf der Flucht erkennen würde.
Sie sprengten auf Pferden durch die Porta Latina, das südliche Stadttor, östlich um Rom herum nach Norden, die Prätorianergarnison an der Via Nomentana meidend. Regen peitschte ihre Gesichter.